Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation
 Beschrijving
Beschrijving
Bol Partner
Erster Abschnitt:Die Reformation in Deutschland"Reformation der Kirche" - dieser KampfRuf stammt nicht aus derBewegung, die mit demWittenberger Augustinermönch Martin Lutherund seinen 95 Thesen begann und im 16. Jahrhundert inDeutschland und vielen europäischen Ländern zu einer grundlegendenNeugestaltung der Kirche und zum Abfall von Rom führte."Reformation der Kirche" - dies war die Parole der Reformbewegungdes frühen 15. Jahrhunderts. Jener Bewegung, die auf den Konzilienvon Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449) zugleichmit der Überwindung des Schismas zwischen Rom und Avignonauch eine Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern, eine "reformatioecclesiae in capite et membris" erreichen wollte. Aber diegroße kirchliche Reformbewegung des Spätmittelalters war gescheitert.Der Versuch der auf dem Konzil von Basel repräsentiertenabendländischen Gesamtkirche, eine universale, die ganze europäischeChristenheit und das gesamte geistliche und weltliche Lebenumfassende Reformation insWerk zu setzen, wurde von Rom vereitelt.Denn durch die Reformation wäre das Papsttum aus seinermonarchischen Stellung verdrängt und das Konzil als höchste kirchlicheGewalt über das Papsttum gestellt worden. Indem dasPapsttum den Angriff auf seine Machtstellung abschlug und denKonziliarismus verdammte, trug es den Gedanken der Reformationder Kirche mit zu Grabe. Für das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundertsvollends verweltlichte Renaissancepapsttum, dessen Interessensich ganz auf seinen italienischen Kirchenstaat richten, ist dasThema "Reformation der Kirche" von der Tagesordnung verschwunden.Daß es im frühen 16. Jahrhundert wieder auftaucht undnun zur Parole einer die Einheit der abendländischen Christenheitspaltenden kirchlichen Revolution wird, geht nicht zuletzt auf dieVersäumnisse und Fehlschläge des Konzilsjahrhunderts zurück.Die konziliare Reformbewegung des 15. Jahrhunderts war einegesamteuropäische Bewegung gewesen. Ihr geistiges Zentrum lag inder Universität Paris. Die Reformation des 16. Jahrhunderts ist imAnsatz keine gesamteuropäische Bewegung mehr, sie geht allein vonDeutschland, von einer recht unbedeutenden deutschen Provinz-2universität aus. Das hat seinen Hauptgrund in der letztlich unableitbarenTatsache des Auftretens von Martin Luther. Aber niemals hättenLuthers 95 Thesen eine reformatorische Bewegung in Deutschlandhervorrufen können, wenn nicht gerade hier das Verlangennach der Reformation der Kirche so lebendig geblieben wäre wie inkeinem anderen Land.DieWiederherstellung seiner Macht in der Mitte des 15. Jahrhundertshatte das Papsttum mit großen Zugeständnissen an die europäischenMächte erkauft. Es mußte zusehen, wie Frankreich in derPragmatischen Sanktion von Bourges (1438) seine gallikanischenFreiheiten gegenüber Rom proklamierte, die Reformdekrete desBasler Konzils übernahm, die französische Kirche ganz dem kurialenEinfluß entzog. Noch unmittelbar vor Ausbruch der deutschenReformation hat Rom im Konkordat mit Frankreich (1516) dessennationalkirchliche Freiheiten anerkennen müssen. Auch die beidenanderen großen Nationen Westeuropas, England und Spanien, hattensich ein hohes Maß von Selbständigkeit gegenüber Rom erkämpft,waren auf dem Wege, die katholische Kirche in den Staateinzuordnen. Nur in Deutschland, das durch die Tradition des HeiligenRömischen Reichs besonders eng mit Rom verbunden war,hat das Papsttum seinen Einfluß wiedergewinnen und in der nachkonziliarenÄra sogar noch weiter ausbauen können. Das unterKaiser Friedrich III. abgeschlossene Wiener Konkordat von 1448,das formell bis zum Ende des alten Reiches in Geltung blieb, machtedem Papst weitgehende Zugeständnisse und vereitelte jede Reform.Der Papst erhielt maßgeblichen Einfluß auf die Besetzungder geistlichen Stellen - mehr als die Hälfte der deutschen Stiftspfründenwurde von Rom vergeben - und er empfing außerordentlichhohe Einnahmen aus der Besteuerung der deutschen Kirche(Palliengelder, Servitien, Expektanzen, Annaten usw.). Zwar habeneinzelne deutsche Fürsten in der Folgezeit günstigere Vereinbarungenmit Rom erzielt, sie haben sich ähnliche landesherrliche Kirchengewaltzusichern lassen wie die westeuropäischen Monarchen- hier liegen die Ansätze zum landesherrlichen Kirchenregiment inDeutschland. Aufs Ganze bleibt Roms Einfluß in Deutschland bedrückendstark, stärker als in Frankreich, England und Spanien.Nirgendwo in diesen Ländern hätte ein kuriales Finanzgeschäft abgewickeltwerden können von der Art des die deutsche Reformationauslösenden Ablaßhandels.Die Reformation in Deutschland3Bald nach dem Abschluß des Wiener Konkordats, auf einemFrankfurter Kurfürstentag 1456, sind die "Gravamina der deutschenNation" zusammengestellt worden, eine Sammlung der Deutschlanddurch den römischen Stuhl auferlegten Beschwernisse. Die Gravaminaklagen Rom an, Deutschland nur als Objekt der Ausbeutung zubetrachten. Sie beklagen die Eingriffe in die Stellenbesetzung, die finanzielleAussaugung, die Willkür der päpstlichen Gerichtsbarkeit."Nicht die Kirche selbst wird da angegriffen, es ist vielmehr ein einzigerSchrei der Empörung gegen die Ungebühr der Regierung in Rom:Der Papst ist der Todfeind der deutschen Nation, denn er vernichtetihren Reichtum, ihre Freiheit und ihre Ehre" (R. Stadelmann). Aufden deutschen Reichstagen immer wieder vorgetragen, amVorabendder Reformation vom nationalbewußten deutschen Humanismusaufgenommen, haben die Gravamina ein romfeindliches Klima geschaffen,noch ehe Luther hervorgetreten ist. "Ohne die Gravaminader deutschen Nation hätte die Nation jenem ersten Ruf Luthersnicht geantwortet, wäre Luther nicht zum Reformator geworden,wäre die Reformation nicht gekommen." (J. Lortz).Das geistige Klima Deutschlands am Vorabend der Reformationwar romfeindlich, aber es war nicht kirchenfeindlich und schon garnicht irreligiös. Im Gegenteil: wohl nie hat kirchliches Leben inDeutschland so geblüht wie um 1500. Die Kirche ist in allen Schichtennoch fraglos als die geistig führende Macht anerkannt. Die skeptischenund paganistischen Strömungen der Renaissance, die in Italienund Frankreich eine höhere Bildungsschicht von Kirche undChristentum entfremden, fanden in Deutschland kaum Wurzelboden.Der deutsche Humanismus war, von Einzelgestalten wie ConradCeltis abgesehen, eine Bildungsbewegung, die mit ihrer Abwendungvon der Scholastik und Metaphysik und ihrer Hinwendungzur Philologie und Geschichte allenfalls die Schäden von Theologieund Kirche kritisierte, doch die religiösen Grundlagen der mittelalterlichenKirche nicht verließ. Ja, imWerk des Erasmus von Rotterdamging der Humanismus soeben die Verbindung mit der christlichenTheologie ein, bildete sich zu einem biblischen Humanismusweiter, dessen reformerische Impulse auf eine innere Erneuerung derChristenheit im Geist des biblischen Altertums zielten, den Rahmender bestehenden Kirche aber nirgendwo sprengten.Die humanistische Pädagogik verband sich bei den "Brüdern vomgemeinsamen Leben"
Erster Abschnitt:Die Reformation in Deutschland"Reformation der Kirche" - dieser KampfRuf stammt nicht aus derBewegung, die mit demWittenberger Augustinermönch Martin Lutherund seinen 95 Thesen begann und im 16. Jahrhundert inDeutschland und vielen europäischen Ländern zu einer grundlegendenNeugestaltung der Kirche und zum Abfall von Rom führte."Reformation der Kirche" - dies war die Parole der Reformbewegungdes frühen 15. Jahrhunderts. Jener Bewegung, die auf den Konzilienvon Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449) zugleichmit der Überwindung des Schismas zwischen Rom und Avignonauch eine Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern, eine "reformatioecclesiae in capite et membris" erreichen wollte. Aber diegroße kirchliche Reformbewegung des Spätmittelalters war gescheitert.Der Versuch der auf dem Konzil von Basel repräsentiertenabendländischen Gesamtkirche, eine universale, die ganze europäischeChristenheit und das gesamte geistliche und weltliche Lebenumfassende Reformation insWerk zu setzen, wurde von Rom vereitelt.Denn durch die Reformation wäre das Papsttum aus seinermonarchischen Stellung verdrängt und das Konzil als höchste kirchlicheGewalt über das Papsttum gestellt worden. Indem dasPapsttum den Angriff auf seine Machtstellung abschlug und denKonziliarismus verdammte, trug es den Gedanken der Reformationder Kirche mit zu Grabe. Für das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundertsvollends verweltlichte Renaissancepapsttum, dessen Interessensich ganz auf seinen italienischen Kirchenstaat richten, ist dasThema "Reformation der Kirche" von der Tagesordnung verschwunden.Daß es im frühen 16. Jahrhundert wieder auftaucht undnun zur Parole einer die Einheit der abendländischen Christenheitspaltenden kirchlichen Revolution wird, geht nicht zuletzt auf dieVersäumnisse und Fehlschläge des Konzilsjahrhunderts zurück.Die konziliare Reformbewegung des 15. Jahrhunderts war einegesamteuropäische Bewegung gewesen. Ihr geistiges Zentrum lag inder Universität Paris. Die Reformation des 16. Jahrhunderts ist imAnsatz keine gesamteuropäische Bewegung mehr, sie geht allein vonDeutschland, von einer recht unbedeutenden deutschen Provinz-2universität aus. Das hat seinen Hauptgrund in der letztlich unableitbarenTatsache des Auftretens von Martin Luther. Aber niemals hättenLuthers 95 Thesen eine reformatorische Bewegung in Deutschlandhervorrufen können, wenn nicht gerade hier das Verlangennach der Reformation der Kirche so lebendig geblieben wäre wie inkeinem anderen Land.DieWiederherstellung seiner Macht in der Mitte des 15. Jahrhundertshatte das Papsttum mit großen Zugeständnissen an die europäischenMächte erkauft. Es mußte zusehen, wie Frankreich in derPragmatischen Sanktion von Bourges (1438) seine gallikanischenFreiheiten gegenüber Rom proklamierte, die Reformdekrete desBasler Konzils übernahm, die französische Kirche ganz dem kurialenEinfluß entzog. Noch unmittelbar vor Ausbruch der deutschenReformation hat Rom im Konkordat mit Frankreich (1516) dessennationalkirchliche Freiheiten anerkennen müssen. Auch die beidenanderen großen Nationen Westeuropas, England und Spanien, hattensich ein hohes Maß von Selbständigkeit gegenüber Rom erkämpft,waren auf dem Wege, die katholische Kirche in den Staateinzuordnen. Nur in Deutschland, das durch die Tradition des HeiligenRömischen Reichs besonders eng mit Rom verbunden war,hat das Papsttum seinen Einfluß wiedergewinnen und in der nachkonziliarenÄra sogar noch weiter ausbauen können. Das unterKaiser Friedrich III. abgeschlossene Wiener Konkordat von 1448,das formell bis zum Ende des alten Reiches in Geltung blieb, machtedem Papst weitgehende Zugeständnisse und vereitelte jede Reform.Der Papst erhielt maßgeblichen Einfluß auf die Besetzungder geistlichen Stellen - mehr als die Hälfte der deutschen Stiftspfründenwurde von Rom vergeben - und er empfing außerordentlichhohe Einnahmen aus der Besteuerung der deutschen Kirche(Palliengelder, Servitien, Expektanzen, Annaten usw.). Zwar habeneinzelne deutsche Fürsten in der Folgezeit günstigere Vereinbarungenmit Rom erzielt, sie haben sich ähnliche landesherrliche Kirchengewaltzusichern lassen wie die westeuropäischen Monarchen- hier liegen die Ansätze zum landesherrlichen Kirchenregiment inDeutschland. Aufs Ganze bleibt Roms Einfluß in Deutschland bedrückendstark, stärker als in Frankreich, England und Spanien.Nirgendwo in diesen Ländern hätte ein kuriales Finanzgeschäft abgewickeltwerden können von der Art des die deutsche Reformationauslösenden Ablaßhandels.Die Reformation in Deutschland3Bald nach dem Abschluß des Wiener Konkordats, auf einemFrankfurter Kurfürstentag 1456, sind die "Gravamina der deutschenNation" zusammengestellt worden, eine Sammlung der Deutschlanddurch den römischen Stuhl auferlegten Beschwernisse. Die Gravaminaklagen Rom an, Deutschland nur als Objekt der Ausbeutung zubetrachten. Sie beklagen die Eingriffe in die Stellenbesetzung, die finanzielleAussaugung, die Willkür der päpstlichen Gerichtsbarkeit."Nicht die Kirche selbst wird da angegriffen, es ist vielmehr ein einzigerSchrei der Empörung gegen die Ungebühr der Regierung in Rom:Der Papst ist der Todfeind der deutschen Nation, denn er vernichtetihren Reichtum, ihre Freiheit und ihre Ehre" (R. Stadelmann). Aufden deutschen Reichstagen immer wieder vorgetragen, amVorabendder Reformation vom nationalbewußten deutschen Humanismusaufgenommen, haben die Gravamina ein romfeindliches Klima geschaffen,noch ehe Luther hervorgetreten ist. "Ohne die Gravaminader deutschen Nation hätte die Nation jenem ersten Ruf Luthersnicht geantwortet, wäre Luther nicht zum Reformator geworden,wäre die Reformation nicht gekommen." (J. Lortz).Das geistige Klima Deutschlands am Vorabend der Reformationwar romfeindlich, aber es war nicht kirchenfeindlich und schon garnicht irreligiös. Im Gegenteil: wohl nie hat kirchliches Leben inDeutschland so geblüht wie um 1500. Die Kirche ist in allen Schichtennoch fraglos als die geistig führende Macht anerkannt. Die skeptischenund paganistischen Strömungen der Renaissance, die in Italienund Frankreich eine höhere Bildungsschicht von Kirche undChristentum entfremden, fanden in Deutschland kaum Wurzelboden.Der deutsche Humanismus war, von Einzelgestalten wie ConradCeltis abgesehen, eine Bildungsbewegung, die mit ihrer Abwendungvon der Scholastik und Metaphysik und ihrer Hinwendungzur Philologie und Geschichte allenfalls die Schäden von Theologieund Kirche kritisierte, doch die religiösen Grundlagen der mittelalterlichenKirche nicht verließ. Ja, imWerk des Erasmus von Rotterdamging der Humanismus soeben die Verbindung mit der christlichenTheologie ein, bildete sich zu einem biblischen Humanismusweiter, dessen reformerische Impulse auf eine innere Erneuerung derChristenheit im Geist des biblischen Altertums zielten, den Rahmender bestehenden Kirche aber nirgendwo sprengten.Die humanistische Pädagogik verband sich bei den "Brüdern vomgemeinsamen Leben"
BolDie inzwischen als Standardwerk geltende Darstellung, von der hier die siebte, durchgesehene Auflage vorliegt, ist seit der funften Auflage 2000 durch ein umfangreiches zusatzliches Kapitel erweitert, das die Kirchengeschichte bis zum Ende des 20. Jahrhunderts weiterfuhrt und dabei der Kirchengeschichte der DDR sowie den Fortschritten und Ruckschlagen der Okumene besondere Aufmerksamkeit widmet. Aus Rezensionen zu fruheren Auflagen: "So bietet der Band wegen seiner sachlichen und klaren Sprache fur den behandelten Zeitraum einen brauchbaren Uberblick, nicht nur fur Studierende, sondern auch fur Pfarrer bei der Vorbereitung kirchengeschichtlicher Themen in Gemeinde und Unterricht." Jahrbuch fur Schlesische Kirchengeschichte Bd. 72 (1993), S. 268-269.
AmazonPages: 365, Edition: 8. durchgesehene, Paperback, UTB GmbH
 Prijshistorie
Prijshistorie
Prijzen voor het laatst bijgewerkt op:

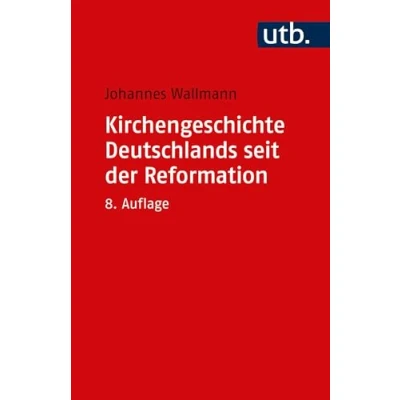










 Productspecificaties
Productspecificaties Gerelateerde
Gerelateerde  Naar shop
Naar shop




